
Erwachsene Menschen unterscheiden sich darin, wie wichtig ihnen Gerechtigkeit ist und wie stark negativ sie auf Ungerechtigkeit reagieren – kurz: wie hoch ihre Ungerechtigkeitssensibilität ist. Doch gibt es diese Unterschiede auch schon bei Kindern? Und ist Ungerechtigkeitssensibilität bei Kindern überhaupt schon zuverlässig messbar? Diese und weitere Fragen hat sich ein Forschungsteam an der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB) und der Universität Konstanz unter Leitung von Prof. Dr. Rebecca Bondü gestellt und 361 Kinder und ihre Eltern daraufhin befragt.
Die Ergebnisse bieten nun spannende neue Einblicke in die frühe Entwicklung gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitsmerkmale. Denn individuelle Unterschiede in der Ungerechtigkeitssensibilität können tatsächlich schon zwischen 6 und 10 Jahren zuverlässig erfasst werden, sowohl durch Befragungen der Kinder selbst als auch von deren Eltern. Die individuelle Bedeutsamkeit von Gerechtigkeit prägt sich somit wohl schon früh aus und nimmt daher womöglich frühzeitig und langfristig Einfluss auf Erleben und Verhalten.
Für die Forscher besonders interessant war, dass sie schon im mittleren Kindesalter eine ähnliche Struktur von Ungerechtigkeitssensibilität wie im Erwachsenenalter vorfanden. So zeigten Kinder, denen insbesondere die gerechte Behandlung anderer wichtig ist, mehr prosoziales Verhalten und höhere soziale Kompetenzen als die, denen dies nicht so wichtig ist. Kinder, die sich selbst oft benachteiligt fühlen, denen Gerechtigkeit also insbesondere für sich selbst wichtig ist, zeigten hingegen mehr aggressives und weniger prosoziales Verhalten, als Kinder, die nicht dazu neigen, sich selbst ungerecht behandelt zu fühlen. Diese Kinder zeigten nach Angaben der Eltern zudem eine höhere Neigung, mit negativen Emotionen, insbesondere mit Ärger zu reagieren. Ungerechtigkeitssensibilität ist also schon im Kindesalter messbar und potentiell verhaltenswirksam.
Die Studienergebnisse werden in Kürze im Journal of Personality Assessment veröffentlicht werden. Der Artikel ist online verfügbar unter: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223891.2020.1753754 (Strauß, S., Bondü, R. & Roth, F. (2020). Justice sensitivity in middle childhood: Measurement and location in the temperamental and competencies space. Journal of Personality Assessment. doi:10.1080/00223891.2020.1753754. Online ahead of print.)
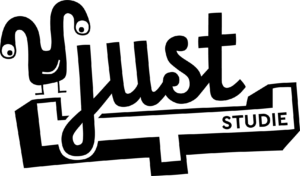
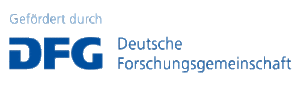
 Die Psychologische Hochschule Berlin heißt Josua Handerer als neuen Schwerpunktleiter für die neue Approbationsausbildung in Systemischer Therapie herzlich willkommen!
Die Psychologische Hochschule Berlin heißt Josua Handerer als neuen Schwerpunktleiter für die neue Approbationsausbildung in Systemischer Therapie herzlich willkommen! Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind laut ihrer Berufsordnung dafür verantwortlich, dass ihre Berufsausübung aktuellen Qualitätsanforderungen entspricht. Hierzu haben sie angemessene qualitätssichernde Maßnahmen zu ergreifen. Doch herrscht keine Einigkeit darüber, wie solche Maßnahmen genau beschaffen sein sollen. In einer Veranstaltung der Psychotherapeutenkammer Berlin wird Prof. Dr. Frank Jacobi, Prorektor der PHB und Leiter der Approbationsausbildung in Verhaltenstherapie, gemeinsam mit Kollegen über Möglichkeiten, Chancen und Risiken von Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Psychotherapie diskutieren.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind laut ihrer Berufsordnung dafür verantwortlich, dass ihre Berufsausübung aktuellen Qualitätsanforderungen entspricht. Hierzu haben sie angemessene qualitätssichernde Maßnahmen zu ergreifen. Doch herrscht keine Einigkeit darüber, wie solche Maßnahmen genau beschaffen sein sollen. In einer Veranstaltung der Psychotherapeutenkammer Berlin wird Prof. Dr. Frank Jacobi, Prorektor der PHB und Leiter der Approbationsausbildung in Verhaltenstherapie, gemeinsam mit Kollegen über Möglichkeiten, Chancen und Risiken von Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Psychotherapie diskutieren.